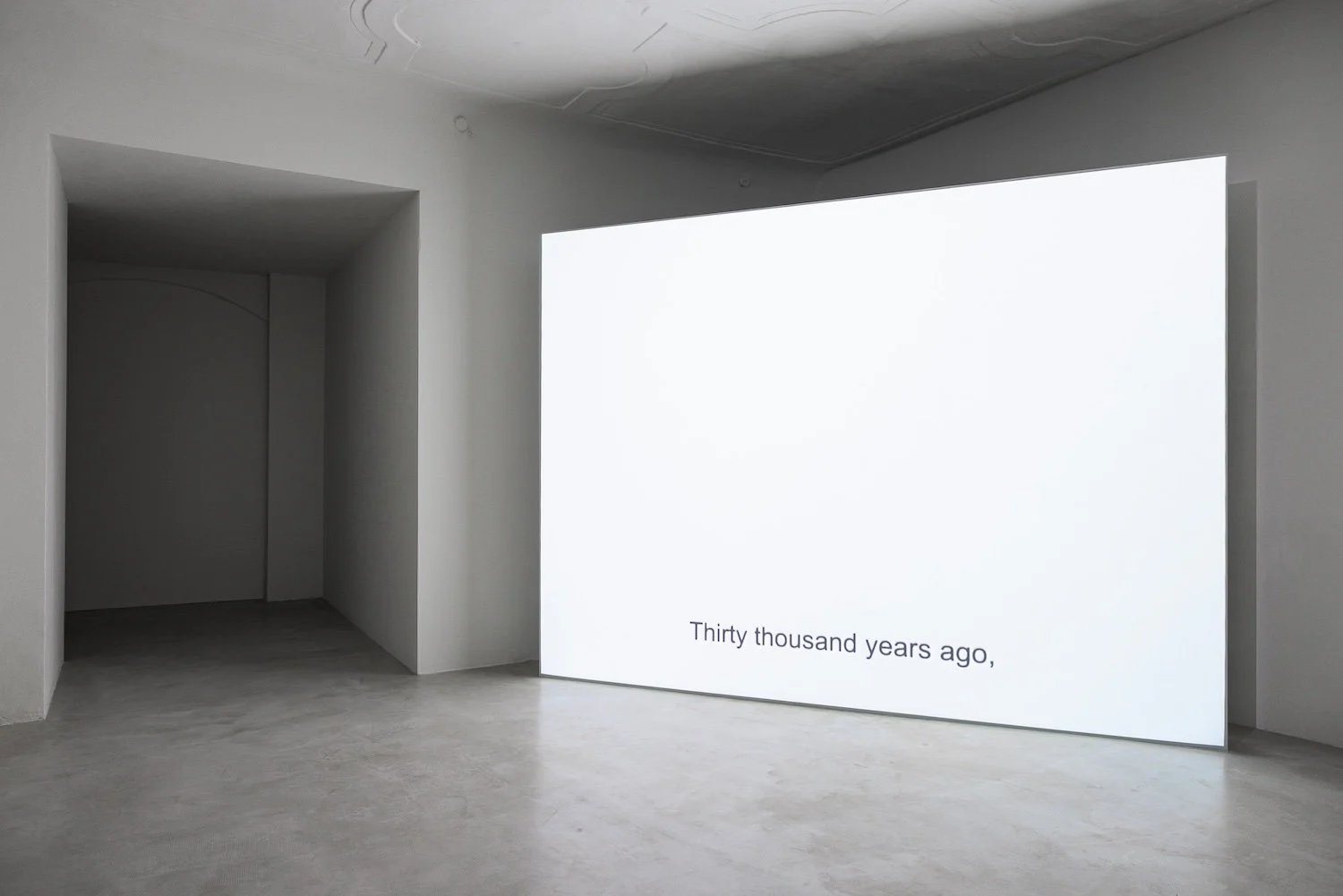On Influence
Ariane Mueller. Fish are folded into the sea just as the sea is folded into fish, Ausstellungsansicht Secession 2025
Foto: Oliver Ottenschläger
Paul Cézanne, Adolf Loos, Marcel Duchamp, Tony Conrad oder Brassaï: Referenzen als konkrete Vorbilder oder Bezugssetzungen sind derzeit in Ausstellungen in der Wiener Secession, im fjk3 oder im Grazer Kunstverein auffallend ausgeprägt. Bezogen auf Strategien von Autorschaft weichen diese auf jeweils unterschiedliche Art von historischen Beispielen ab, wie wir sie etwa von der Appropriation Art, von Reenactment künstlerischer Positionen oder von jenen dokumentarisch motivierten Narrativen der 1990er Jahre kennen. Zwar werden ebenso Genealogien abgerufen und diese in Kontexte eingegliedert, die nun aber weitläufigeren und bisweilen individualistischeren Gedankengängen ausgesetzt scheinen und vor allem eigensinnig anmuten. Es ist Einiges an Information nötig, will man die Prozesse und Hintergründe der in den Ausstellungen gezeigten Werke ergründen, wozu ausführliche Ausstellungsbegleiter eine Hilfe sind. Diese bemühen sich um Verständlichkeit komplexer Vorgänge, die, so könnte man meinen, eher künstlerischen Ursprungs sind, als dass sie eine kuratorische Korrektur erfahren haben.
Gegenüber dem Sehen ist ein Überhang des Denkens, wie ihn etwa Jean-Francois Lyotard für die Postmoderne beschrieben hat, gegeben, wenn sich „das Empfindend-Empfindbare und das Sagend-Sagbare“ merklich ausweiten.(1) Was die Konstruktion von Autorschaft betrifft, ist die historische Referenz dabei ebenso wichtig wie unwichtig, weil sich die Rollen von Vorbild und „Nachbild“ vom Aktiven ins Passive verschoben haben. Dass etwa Jean-Michel Basquiat von Vincent van Gogh beeinflusst war, ist dann lediglich ein überholter und rückwärtsgewandter Ansatz, weil van Gogh kein aktiver Partner mehr sein kann und somit das Umgekehrte der Fall ist: “You’ve got to realize that influence is not influence. It’s simply someone’s idea going through my new mind.”(2) Henrik Olesen schreibt im Katalog der Ausstellung von Ariane Mueller in der Secession, in der die Künstlerin Bilder im Stil von Cézanne zeigt: „Die Erhabenheit der Pinselstriche Cézannes wird zu einem Kollektiv an Stimmen und Erfahrungen, Erinnerungen und Emotionen, Transzendenz: Cézanne ist ein Kollektiv“.(3) Sein Text, der sich auf Bildtitel und Werke bezieht, die er durch Muellers Paraphrasen betrachtet und beschreibt, baut eine Kette von Referenzen auf. Vom „Original“ haben sie sich längst entfernt, setzen hingegen ein eloquentes Narrativ in Gang.
Ariane Mueller. Fish are folded into the sea just as the sea is folded into fish, Ausstellungsansicht Secession 2025
Foto: Oliver Ottenschläger
Ihre Ausstellung Fish are folded into the sea just as the sea is folded into fish beschreibt Mueller im Ausstellungsbegleiter „als Irritation“, wenn es der Krieg ist, der ihr Denken immer wieder unterbricht. Aus ihren verschiedenen Erfahrungen dazu und resultierend aus der derzeitigen Situation war ihre Hinwendung zu Landschaftsbildern als eine Entscheidung erfolgt, sich „angesichts des Krieges aus dem Zentrum in die Abgeschiedenheit, in das Schweigen zurückzuziehen“ und sich mit „zeitlosen malerei-spezifischen Themen auseinanderzusetzen“ (Ausstellungsbegleiter). Der Raum der Secession ist zweigeteilt, wobei Pablo Picassos Kapelle von Vallauris das Vorbild abgab, in der er, wie nun auch Mueller, den Raum in Krieg und Frieden unterteilte. Mueller zeigt nun auf der linken, dem Krieg zugeordneter Seite die bereits erwähnten Malereien, auf der rechten einige ihrer Videoarbeiten. Picasso scheint in ihrem Werk immer wieder eine Rolle zu spielen, wie sie viel Zeit vor jenem Atelier Picassos in der Pariser Rue des Grands Augustins verbrachte, wo er Guernica gemalt hatte, und von dem Gebäude auch ein Gemälde anfertigte. Die großformatigen Bilder in der Secession haben Bildtitel wie In this serious time, What one could no longer imagine oder When this is happening, verstehen sich als „Holzwege“ und nehmen den Duktus von einigen Aquarellen von Cézanne auf, dessen Handschrift sich Mueller zu Eigen macht. Viel kunsthistorisches Wissen ist nicht gefragt, wenn Cézanne als Landschaftsmaler apostrophiert wird, der den Weg in die Abstraktion ebnete. Welch haltlose den Künstler reduzierende Aussage, wie offensichtlich grundlegende Errungenschaften Cézannes, die Bildraum und -struktur betreffen, keine Bedeutung mehr haben. Mueller spricht von „Distanz“, die sie zu Cézanne aufbaut. Die Bilder im großen Format wirken lyrisch und sanft, verglichen mit der angeblich von Picasso stammenden dramatischen Beschreibung der Kunst Cézannes, die vom rhythmischen Aufprallen des Raums auf die Form spricht. Mueller nimmt von Cézanne ja auch nur die Oberfläche. Dabei ist der Meisterdiskurs Cézannes offensichtlich nicht ironisch eingesetzt und scheint auch sonst keinerlei andere kunsttheoretische Fragen zu bedienen. 1992 war es Renée Green in ihrem offenen Brief „On Influence“ noch wichtig, ein Korrektiv zur männlichen Dominanz aufzuzeigen und eine diskursive Praxis zu erweitern.(4) Diese ist nun individualistisch ausgeprägt mit Cézanne als visuell appropriierte „Marke“, die wie Bilder auf Instagram schnelles Erkennen und Konsumieren ermöglicht, während sich „Zeit und Bewegung außerhalb der Bilder“(5) abspielen.
Lucy McKenzie, Duchamp Mannequin (1938), 2025 und Monumental Street Lamp mit Duchamp Mannequin Sketches, 2017-2024, Ausstellungsansicht Lucy McKenzie, Orchestrion, fjk3 - Raum für zeitgenössische Kunst 2025
Foto: Lisa Rastl
Auch Lucy McKenzie hält sich an große Namen wie Loos oder Duchamp. In ihrer Ausstellung Orchestrion bezieht sie sich zusätzlich auf Formate der Unterhaltungskultur um 1900 sowie auf andere historische und kunsthistorische Bezugspunkte wie Panorama, Schaufenster oder Trompe-l'œil. Sie konfrontiert das Publikum mit einer Vielzahl von Referenzen, deren Zusammenhang sich im Rahmen der Ausstellung nicht erschließt. Einen Schwerpunkt bildet der Bezug auf Loos mit einem deutlich feministischen Ansatz. Laut Ausstellungsbegleiter wird „die Gegenwart durch das Prisma der Vergangenheit“ gesehen: „nicht nostalgisch, sondern mit scharfem Blick für das Potential der Geschichte als Raum für radikale Neubewertung.“ Noch kürzlich hat die Künstlerin anlässlich ihrer Ausstellung in der Tate Liverpool betont, dass sie keine Dinge „for a very very specific kind of our audience“ machen wollte, die nur von einem belesenen und fachkundigen Publikum verstanden werden könnten.(6) Wie ist es nun in Wien und dem Bezug zur Geschichte? Nostalgisch ist dieser mit seinen Themen allemal, die einem Wiener Publikum mehr als geläufig sind, zumal der sexuelle Missbrauch von Loos oder die Vergnügungsstätten im Prater längst umfangreich aufgearbeitet sind. McKenzie spricht nicht im Namen von Recherche und Wissen, die sie natürlich auch macht, sondern extrahiert daraus einzelne Aspekte in Malereien und Objekten, die aber kaum zu einem „Orchestrion“ werden, wie auch das Objekt selbst stumm und Attrappe bleibt und einer der Einzelgänger ist, aus denen sich die Ausstellung zusammensetzt.
Ein solcher ist auch die Puppe, die jener von Duchamp aus der legendären Exposition internationale du Surréalisme von 1938 wörtlich nachempfunden ist. Inmitten der 16 Schaufensterpuppen, die den schönsten Pariser Straßen zugeordnet waren, hat Duchamp eine Version von „Rrose Selavy“ gewählt, die mit Hut, Perücke und Sakko nun am Boden sitzt. Die gesamte Ausstellung muss düster, bizarr und dunkel gewesen sein, nun ist alles hell und klar. Das Motiv der kleinen roten Glühbirne, die Im Sakko steckte, wird in einer modernistischen Straßenlampe aufgegriffen, ergänzt mit Zeichnungen von Beca Lipscombe. Als Architektur- oder Designobjekt und auch vom Material her ähnelt sie dem Salonfragment von Loos aus der Villa Müller im Stock darunter.
Lucie McKenzie, Mural Proposal for Jeffrey Epstein’s New York Townhouse (Filming of American Psycho), 2024 (im Hintergrund Karussellorgel (Orchestrion), 1931/32, Wien Museum), Ausstellungsansicht Lucy McKenzie, Orchestrion, fjk3 - Raum für zeitgenössische Kunst 2025
Foto: Lisa Rastl, Courtesy (Wandmalerei): Cabinet Gallery, London
Attraktion gepaart mit rhetorischer Illusion: Was das Trompe-l'œil betrifft, ist McKenzie Meisterin. Dabei verwendet die Ausstellung den Begriff bisweilen abseits seiner kunsthistorischen Definition. Trompe-l'œil im Pantheon? Und in ihren Wandbildern? Mural Proposal for Jeffrey Epstein’s New York Townhouse (Filming of American Psycho) stellt eine Szene aus dem Filmset von American Psycho dar, in der der Hauptdarsteller Christian Bale unter der Dusche steht und, wie es die Erzählung will, vom weiblichen Filmteam bestaunt wird. Man denkt weniger an Trompe-l'œil als an schräge Szenen von Balthus oder Beispiele verschiedenster Murales. Mit ihren vielfältigen Referenzen balanciert McKenzie Autorschaft zwischen Fiktion und Nichtfiktion und lässt Material und handwerkliche Skills, Design und Mode über alles walten, auch über das unübersichtliche „Prisma der Vergangenheit“.
James Richards, Negative Hands, 2024, Ausstellungsansicht James Richards. Fevers, Grazer Kunstverein 2025
Courtesy of the artist, Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin, Sylvia Kouvali, Piraeus/London und Grazer Kunstverein, Foto: kunst-dokumentation.com
In seiner aktuellen Ausstellung im Grazer Kunstverein zeigt James Richards unter dem Titel „Fevers“ drei Filme, die alle 2024 und 2025 entstanden sind. Die Hitze des Fiebers beeinträchtigt die Wahrnehmung, „wenn ein Bild zu lange verweilt, wenn ein Klang sich unter die Sprache schleicht“ (Ausstellungsbegleiter), wenn nichts mehr stabil ist, Erinnerungen täuschen und Bilder stottern oder flackern, wie Richards in seinem digitalen Video Negative Hands ein 4K-Bootleg von Tony Conrads The Flicker mit dem geschriebenen Text aus dem Film Les Mains Négatives von Marguerite Duras verbindet. The Flicker (1966) ist ein Schlüsselwerk des strukturellen Experimentalfilms, in dem schwarze und weiße Bilder in hoher Geschwindigkeit ein Flackern erzeugen, das das Sehen in Unruhe versetzt bzw. beeinträchtigt. Lyotard hat den Film als Inbegriff des „Hinkens“ verbunden mit Vorstellungen des Inhumanen und Entkörperlichten gesehen.(7) Zusätzlich sind in Richards digitalisierter Bootleg-Version weitere Verzerrungen angelegt. Der Text, den Marguerite Duras im Film von 1978 auch selbst spricht, begleitet eine frühmorgendliche Kamerafahrt durch Paris und evoziert die „mains négatives“ prähistorischer Höhlen: Abdrücke von Händen, deren Umrisse vor 30 000 Jahren, wie es im Film heißt, mit Pigmenten fixiert wurden. Ist die Arbeit von Duras bereits ein dialektisches Bild, verdichtet es Richards neuerlich mit weiteren Assoziationen. Berührung und Abwesenheit, Geschichte und aktuelle Dramatik im Film entsprechen verdichteten Zeitspannen. Wenn im Ausstellungsbegleiter von „zwei Formen der Verneinung“ und „Abwesenheit des Bildes“ die Rede ist, wäre dennoch auch vorstellbar, dass zwei Bewegungen aufeinander zukommen, die des Handabdrucks nach innen und jene filmische nach außen, als würden zwei Handflächen aufeinanderstoßen.
(1) Jean-Francois Lyotard, Philosophie und Malerei im Zeitalter ihres Experimentierens, in: ders., Philosophie und Malerei im Zeitalter ihres Experimentierens, Berlin 1986, S. 70.
(2) Zit. nach Austin Kleon: https://austinkleon.com/2018/02/02/the-way-we-talk-about-influence-is-backwards/ (Zugriff: 15.8.2025).
(3) Henrik Olesen, weil es der titel der arbeit ist, in: Ariane Mueller, Fish are folded into the sea just as the sea is folded into fish, Wien-Köln 2025, S. 62.
(4) Renée Green, Open Letter No.1: On Influence, in: Texte zur Kunst 7, 1992, S. 187 ff.
(5) Wie Anm. 3, S. 63.
(6) Lucy McKenzie 2022 in Interview: https://www.youtube.com/watch?v=bbSRSeQI_zw (Zugriff: 15.8.2025).
(7) Jean-Francois Lyotard, „Was man nicht erfliegen kann, muss man erhinken“, in: ders., Philosophie und Malerei im Zeitalter ihres Experimentierens, Berlin 1986, S. 30.